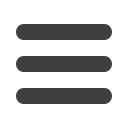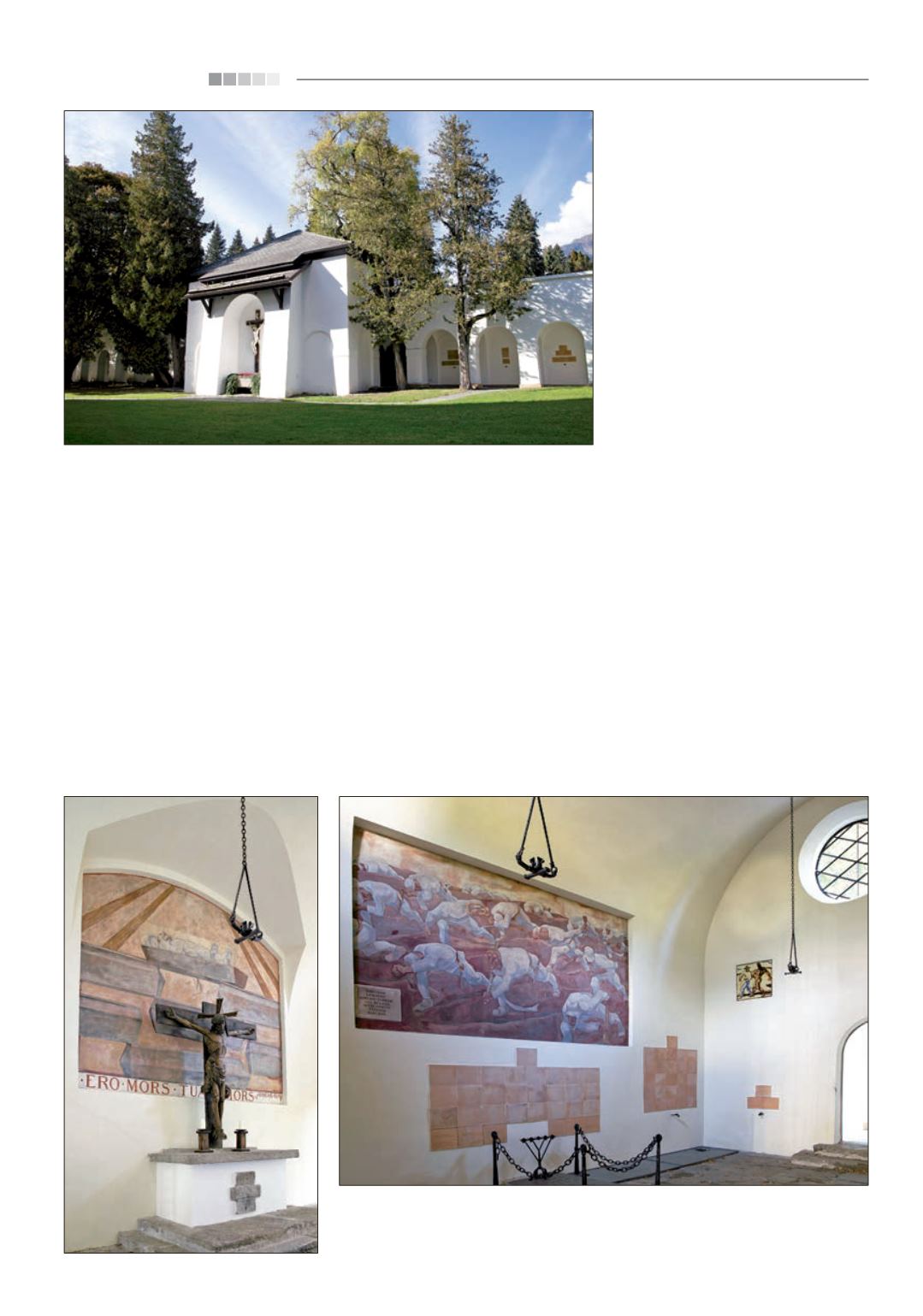
OSTTIROLER
NUMMER 9-10/2018
6
HEIMATBLÄTTER
Viele der 30 Grabmäler imArkadengang
des Neuen Friedhofs erhielten ihre künst-
lerische Ausstattung gleich zu Beginn der
Fertigstellung bzw. in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts. Zwischen
1929 und 1947 ergingen vier Aufträge von
Lienzer Bürgerfamilien an den in Matrei
i. O. geborenen akademischen Bildhauer
Virgil Rainer. Dieser arbeitete und lebte
viele Jahre bis zu seinem Tod 1948 in
Innsbruck. Mit Josef Manfreda, mit dem er
in stetem Austausch stand, verband ihn
unter anderen 1933 die Gründung des aka-
demisch orientierten Tiroler Künstlerbun-
des „Erde“
28
und einhergehend gemein-
schaftliche Ausstellungen in Innsbruck.
Überwiegt an dem monumentalen Hoch-
relief der Grabstätte
Geiger
und
Mahl
aus
dem Jahr 1929 noch der statuarische Cha-
rakter der Gruppe um die Darstellung des
auferstandenen Christus, so bestimmt
am Grabmal
Ladstätter
(datiert 1914)
29
die
lebensgroße Figurengruppe als Interpreta-
tion der vier Lebensalter, in ihrer Ge-
schlossenheit und Plastizität das betont
Skulpturale und die Einheit. Der 1927 er-
schienene Sammelband mit den biografi-
schen Angaben der Künstler Tirols, erlaubt
aufschlussreiche Einblicke in diverse
Künstlerbiografien der Zeit – Virgil Rai-
ners Eintrag stammt aus dem Jahr 1926:
30
„Meine größte Tätigkeit entfaltete ich vor
dem Kriege in Berlin. Der größte Auftrag
den ich dort hatte war das Grabdenkmal
für Familie Ladstätter; leider musste die
Arbeit wegen Kriegsdienst unterbrochen
werden u. konnte der Auftrag bis heute
[1926] noch nicht vollendet werden.“
31
In einer weiteren Beschreibung vermerkt
er außerdem, dass diese Grabplastik für
Domžale in Slowenien bestimmt war …
Die Christusfigur an der Grabstätte der
Familie
Henggi
und
Krasnik
aus dem Jahr
1947 zählt zu den letzten monumentalen
Plastiken des Bildhauers. Die lebensgroße,
Das Bezirkskriegerdenkmal: Nach den Plänen von Clemens Holzmeister (1886-1983) in
den Jahren 1924 und 1925 nördlich der Pfarrkirche St. Andrä erbaut.
Die künstlerische Ausstattung der Kapelle wurde bis auf die Kopie eines gotischen Kru-
zifixes durch Peter Sellemond von Albin Egger-Lienz (1868-1926) übernommen. Auf den
Tontafeln findet man die Namen und Daten der Gefallenen beider Weltkriege aus den
früher 50 Gemeinden des Bezirks Lienz.
lehnt, worauf Franz Walchegger in Anbe-
tracht der Jagdleidenschaft des Auftragge-
bers 1955 das Fresko „Heiliger Hubertus“,
formal plastisch figurativ und in expressi-
ver Farbigkeit, ausführte. In einer 1956 er-
schienenen Rezension über die Fresken,
bezieht sich der Autor und damalige Ku-
stos des Museums Schloss Bruck, Franz
Kollreider, auf die Volkstümlichkeit der
Arbeit Johann B. Oberkoflers, obwohl sich
dieser bezüglich Farbwahl und Gestaltung
anscheinend Anleihen vom akademischen
Maler nahm, was an einigen (stiluntypi-
schen) Freskierungen ersichtlich ist:
„Als
Vertreter der alten Kunstrichtung erfreuen
seine […] farbenprächtigen Bilder naza-
renischer Art, […] verbrämt mit einer ganz
bestimmten, lieblichen Neuromantik, be-
sonders die bäuerliche und ältere Stadt-
bevölkerung.“
27
rasch deutlich, dass dessen Entwürfe die
künstlerisch weniger aufgeschlossene Be-
völkerung bzw. die Besitzer der Grabstät-
ten vermutlich wenig ansprechen würden.
Tatsächlich erging der Auftrag für 16
Wandbilder an den Brixner Priester, Dom-
benefiziaten und Maler Johann Baptist
Oberkofler (1895-1969), der später dazu
seinem Bruder schreiben sollte,
„man hat
sich in Lienz um ihn gerauft […]“
.
24
Der
Priestermaler war bereits davor in den
1920er- und 1930er-Jahren in Osttirol als
Restaurator und Kirchenmaler tätig.
25
Franz Walchegger erhielt jedenfalls nur die
Zusage für eine Arbeit, deren Qualitätsan-
spruch schon damals im Gegensatz zu der
des Priesters stand. Trotzdem, die erste für
die Grabstätte
Alliani
vorgesehene Grab-
tafel
26
mit dem Motiv des „Auferstande-
nen“ wurde von den Grabbesitzern abge-