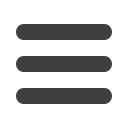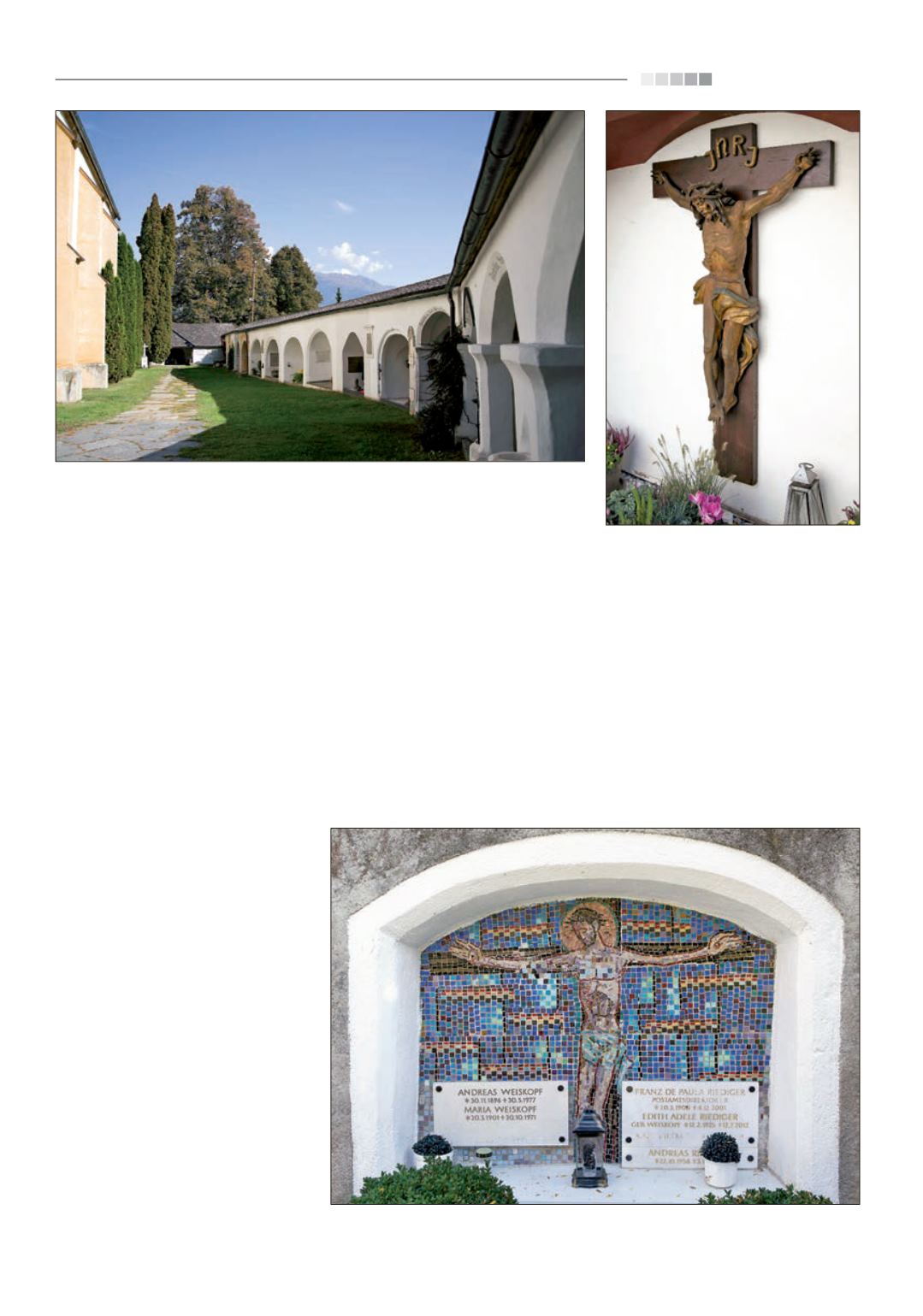
OSTTIROLER
NUMMER 9-10/2018
3
HEIMATBLÄTTER
Stadtverwaltung mit der Idee, für die
Kriegstoten aus dem gesamten Bezirk ein
monumentales Denkmal zu errichten.
13
Ebenfalls zu dieser Zeit setzte sich (in Ein-
vernehmen mit der Stadt Lienz) der in Inns-
bruck erfolgreich tätige Lienzer Architekt,
Bildhauer und Maler Josef Manfreda
(1890-1967) mit konkreten Überlegungen
und Entwürfen auseinander, unter Mitein-
beziehung des heimischen Bildhauers Vir-
gil Rainer (1871-1948) und der Maler
Franz von Defregger (1835-1921), Hugo
Engl (1852-1926) und Albin Egger-Lienz
eine Gedenkstätte zu projektieren. Nach-
dem 1923 ein Denkmal-Ausschuss gegrün-
det wurde, der außerdem in Abstimmung
mit den damals 50 Gemeinden des Bezirks
das Monument umsetzen sollte, wurde
Josef Manfreda somit zur Mitarbeit einge-
laden. Ein weiterer Punkt, der aus einem
traditionell konzipierten Denkmal eine mo-
numentale Anlage mit dem Charakter eines
Gesamtkunstwerks werden lassen sollte,
zollte dem Umstand, dass die klassizisti-
schen Arkaden der Nordwest-Einfassung
schon längst baufällig geworden waren und
der Dekan der Stadtpfarrkirche, Gottfried
Stemberger, sich seit Jahren um die finan-
zielle Unterstützung der Restaurierung be-
mühte. Der Vorschlag des Landeskonser-
vators für Tirol, Dr. Josef Garber, beide
Bauvorhaben nun im Sinn eines geschlos-
senen Ensembles zu verbinden, erhielt die
breite Zustimmung aller Verantwortlichen.
Albin Egger-Lienz, der schon zu dieser Zeit
als renommierte Künstlerpersönlichkeit in
der Öffentlichkeit stand und alleinig für die
Ausstattung der Kapelle verantwortlich sein
sollte, war begeistert über den Auftrag,
einen Gemäldezyklus für die Kapelle in sei-
ner Heimat zu schaffen. Schon im Spät-
herbst 1923
14
präsentierte jedenfalls der von
der Stadt Lienz involvierte Architekt Josef
Manfreda seine Entwürfe dem Ausschuss
(u. a. eine Kapelle in einem Hain mit „Hel-
deneichen“), als er überrascht von der Mit-
arbeit des Architekten Clemens Holzmeis-
ter erfuhr.
15
Josef Garber zog nämlich den
Architekten Clemens Holzmeister für das
vollständige Bauprogramm des Bezirks-
kriegerdenkmals heran, der die Projekt-
pläne seinerseits dann imApril 1924 vorle-
gen konnte – und nur diese wurden schließ-
lich realisiert.
16
Anstelle des Nordportals
wurde unter Miteinbeziehung der angren-
zenden Arkaden die Gedenkstätte errichtet,
deren tonnengewölbter Raum nur durch
zwei in der Höhe eingelassene Rundfenster
und zwei Zugänge Licht von außen erhält:
Mit größtmöglicher Verdichtung des Baues
wird so die maximalste Wirkung für das
Bildprogramm gewährleistet. Die so ge-
nannte Schauseite des Monuments ist durch
zwei markante Wandschrägen gegliedert,
die wiederum eine Nische begrenzen, in der
an der Wand ein Kreuz angebracht ist.
Noch während an den Arkaden gebaut und
gleichzeitig die östliche Friedhofsmauer
mit den Rundbogen-Nischen von Grund
auf restauriert wurde, arbeitete Albin
Egger-Lienz in der Gedächtnisstätte an sei-
nem durchdrungen konzeptuellen Gemäl-
dezyklus, der vier Bildwerke umfasst: Die
Unterglasurmalerei (auf Keramikplatte)
„Sämann und Teufel“, um 1923, die drei
Fresken von 1925 „Die Namenlosen“ oder
„Sturm“, „Die Totenopfer“ und „Der Auf-
erstandene“. Die Kopie eines gotischen
Kruzifixes am Altar stammt von Peter Sel-
lemond (1884-1942). Gerade die Ikono-
grafie der Darstellung des „Auferstande-
Das Kruzifix in der Grabnische Pöll und
Steiner stammt vom Postbeamten und
Holzbildhauer Rudolf Röck (1908-1991)
aus Wenns in Tirol.
Der südliche Arkadenteil verläuft mit einem merkbaren Knick: Ein Teil des Mauerwerks
wird in östlicher Richtung bis zur Kapelle und dem Osteingang mit Zinnen bekrönt. In
diesem Bereich befindet sich auch das letzte freistehende Grab des Areals.
In den Arkaden-Nischen der Ostmauer (Grabstätte Weiskopf und Riediger) findet man die
Darstellung des gekreuzigten Christus als klassisch modern gestaltetes Mosaik des aka-
demischen Bildhauers Josef Troyer (1909-1998).