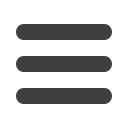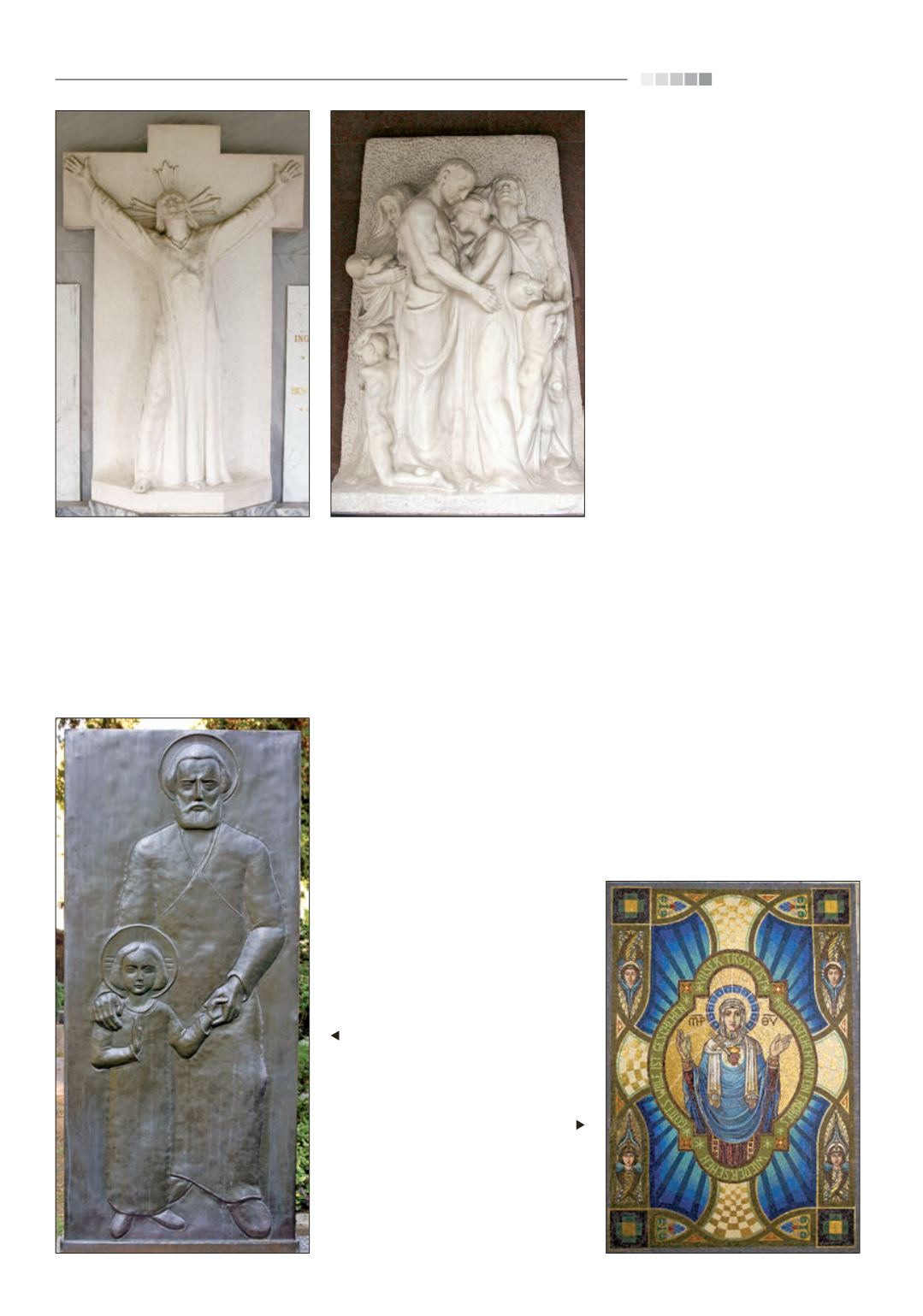
OSTTIROLER
NUMMER 9-10/2018
5
HEIMATBLÄTTER
Befreiung Österreichs, wurde 1965 ein
Mahnmal in der Parkanlage westlich der
Pfarrkirche St. Andrä errichtet. Lienz gilt
somit nach Wien als erste Gemeinde
Österreichs, die sich der zeithistorischen
Aufarbeitung stellte und sie bis heute
aktualisiert.
Ein Friedhof – auch Raum für Kunst
Die spannungsreiche Bauhistorie der ge-
samten Friedhofsanlage wird in einem
nicht minder interessanten Ausmaß von
der künstlerischen Gestaltung der ver-
schiedenen Grabstätten begleitet, die in
„aktuelleren“ Beispielen mit variierenden
Qualitätsansprüchen in einem Zeitraum
von rund 100 Jahren entstanden sind. Die
kunsthandwerkliche Tradition hat sich da-
mals wie heute ihren Stellenwert beibe-
halten, und man findet nicht wenige Bei-
spiele, in denen der künstlerische Aspekt
zur Ausführung nur vorgeblendet ist. Es
liegt an der Gegebenheit der Umgebung,
des Raumes im Freien, dass das Genre der
Malerei nicht übermäßiger vorherrscht als
das der Plastik, der Skulptur oder des
Reliefs in Stein oder in Metall.
Die Ausführungen der Bildhauer (es
sind bis dato übrigens keine Arbeiten von
Künstlerinnen am Lienzer Friedhof be-
kannt) sind mehr oder weniger für die Be-
sitzer der Grabstätten individuell entwor-
fene Grabskulpturen, in deren Vielfältig-
keit doch immer wieder stilistische
Parallelen zu finden sind. Schmiedeeiserne
Kreuzdarstellungen mit und ohne Corpus
Christi, Bronzeplastiken, antikisierende
Reliefs, Mosaike und Fresken sind die
bildnerischen Grabwächter, die im weite-
ren Zusammenhang den Einblick in das
Kunstverständnis in ihrer Zeit der Entste-
hung, nämlich der des Kunstschaffenden
und der seiner Auftraggeber, öffnet. Der
künstlerisch anspruchsvolle Duktus sollte
eigentlich selbstverständlicher Teil der
Qualitätssicherung sein.
Bereits 1956 sah sich der Architekt und
Künstler Josef Manfreda, ehemaliger Pro-
fessor an der Bundesgewerbeschule in
Innsbruck, veranlasst, im Osttiroler Boten
in einem Leserbrief die „Zustände“ am
neuen Friedhof zu kommentieren:
„[…]
Die Mißachtung des Menschen kommt nir-
gends so drückend zum Ausdruck wie im
Gesicht der Friedhöfe, und leider ist auch
im neu angelegten Friedhof von Lienz ein
Verfall der Kultur festzustellen. […] Für
Lienz scheint das degenerative Ende des
Totenkults am Anfang zu stehen […]“.
Er
plädiert weiters für die Installierung einer
künstlerischen Friedhofskommission,
damit
„auch die gegenwärtig vernachläs-
sigte Friedhofskunst und das Kunsthand-
werk wiederum ein reiches und dankens-
wertes Betätigungsfeld [hätten]“.
21
Eine
interessante Stellungnahme Josef Manfre-
das, in der sich der als konservativ-kritisch
bekannte Autor aller Wahrscheinlichkeit
nach auf den 1955 entstandenen Fresken-
zyklus in den 17 zur Verfügung gestellten
Grabnischen der östlichen Arkadenmauer
am Alten Lienzer Friedhof bei der Pfarr-
kirche bezog.
22
Der als öffentlich (Stadt
und Pfarre) behandelte Auftrag sah eine
zeitgenössische, sakral konzipierte, ein-
heitliche Freskenfolge vor, in dem die
heilsgeschichtliche Thematik rund um
„Leben“, „Tod“ und „Auferstehung“
künstlerisch umgesetzt wird. Nun, der
Gesamtauftrag sollte ursprünglich an den
Lienzer akademischen Maler Franz
Walchegger (1913-1965)
23
ergehen, der
bereits im Bezirk Lienz mit teilweise
monumentalen Wandgemälden ernste An-
erkennung fand. Als Vertreter der expres-
siven österreichischen Moderne wurde
Bei den Arkadengräbern am Neuen Friedhof findet man vier aus weißem Marmor ge-
meißelte, plastische Reliefs des Matreier Bildhauers Virgil Rainer (1871-1948). Hier ab-
gebildet „Der Auferstandene“, datiert 1947 (Henggi und Krasnik) und „Die vier Le-
bensalter“, datiert 1914 (Ladstätter).
Die Familiengrabstätte des Lienzer
Architekten und Kunstschaffenden Josef
Manfreda (1890-1967) wird mit
„St. Josef und das Jesuskind“, einer
Treibarbeit aus Bronzeblech, geschmückt.
An den Deckenfeldern im östlichen
Arkadengang des Neuen Städtischen
Friedhofs der beiden Grabstätten Carli
und Kranz findet man unerwartet zwei
Ikonen, die als ornamentreiche Mosaike
des Jugendstils eine „Herz-Jesu-Figur“
mit Segensgestus und eine Mutter Gottes
als „Meter Theou“, begleitet von jeweils
vier Cherubim, darstellen.