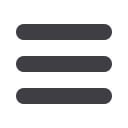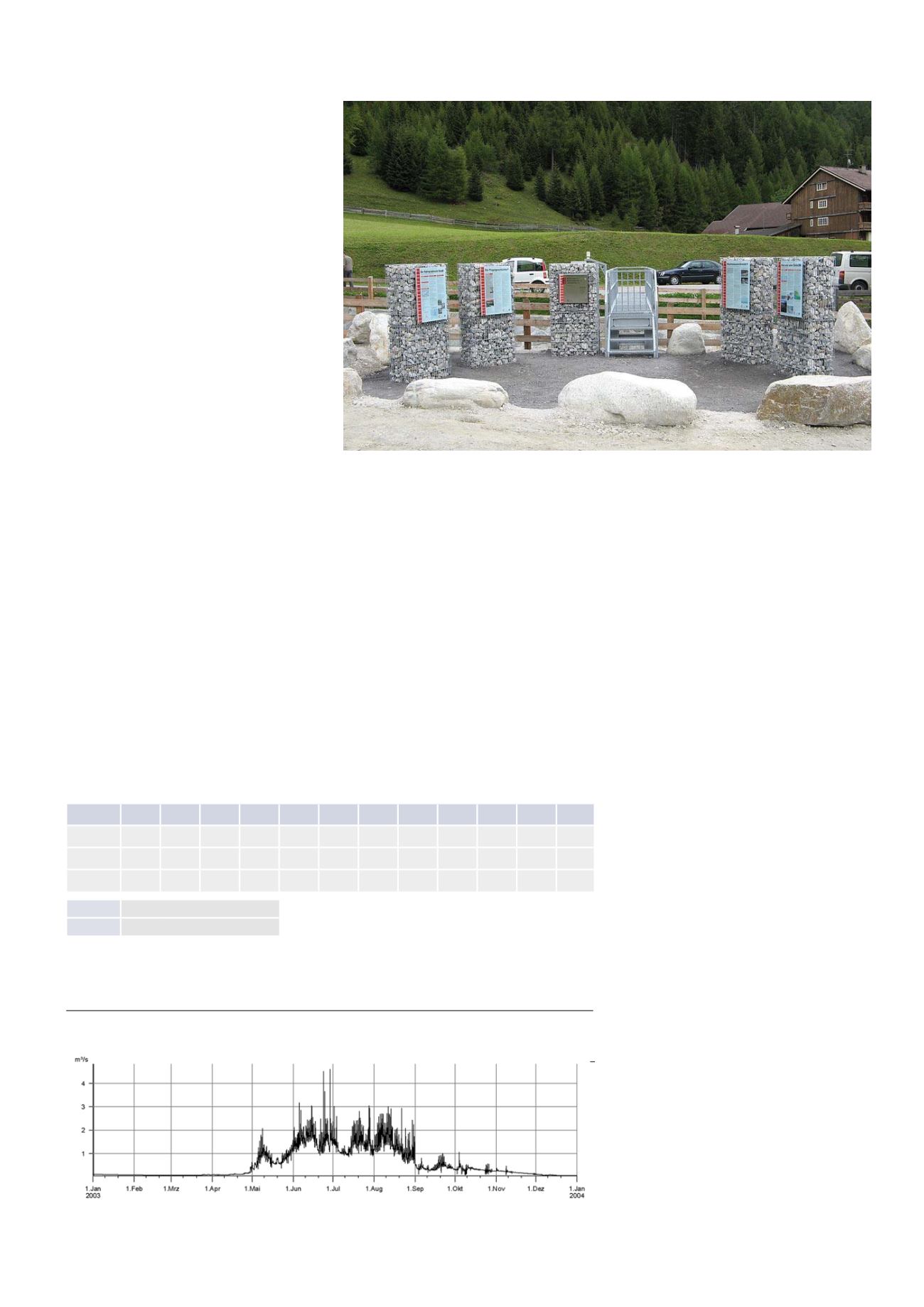
24
FODN - 60/02/2015
UMWELT & NATUR
MiƩlere und extreme Wasserführung am Pegel SpöƩling/Teischnitzbach (Einzugsbgebiet
13,9 km
2
] für jeden Monat aus dem Beobachtungszeitraum 1951 - 2014
Monat
Jan.
Feb.
März April
Mai
Juni
Juli
August Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
NQ [m
3
/s] 0,041 0,037 0,037 0,040 0,045 0,105 0,270 0,184 0,040 0,018 0,027 0,031
MQ [m
3
/s] 0,092 0,077 0,081 0,146 0,554 1,30 1,47 12,18 0,642 0,349 0,191 0,122
HQ [m
3
/s] 0,193 0,160 0,350 1,025 3,62 7,10 22,9 11,0 5,35 3,22 1,42 1,31
NNQ 0,016 m
3
/s am 27. Oktober 1989
HHQ 22,9 m
3
/s am 28. Juli 2006
NQ kleinster Abfluss im Beobachtungszeitraum
MQ miƩlerer Abfluss im Beobachtungszeitraum
HQ größter Abfluss im Beobachtungszeitraum
NNQ kleinster bekannter Abfluss
HHQ größter bekannter Abfluss
Tabelle 1: Charakteristische Wasserführung des Teischnitzbaches am Pegel Spöttling
Die Kunst des Pegelbaues
Um die mittlerweile relativ einfach zu
messenden Wasserstände in Durchflüs-
se umzurechnen, braucht es einen Um-
rechnungsschlüssel, der aus „Zentime-
ter Wasserstand“ -> „Liter pro Sekunde“
macht. Die Lösung: ein individueller
„Pegelschlüssel“ muss angefertigt wer-
den. Der Pegelschlüssel wird wegen sei-
ner Form auch als „Schlüsselkurve“ be-
zeichnet. Zur Erstellung sind zahlreiche
Abflussmessungen erforderlich. Diese
erfolgen mit einem sog. hydrometri-
schen Flügel, der wie ein Propeller vom
fließenden Wasser in Rotation versetzt
wird.
Solche Messungen müssen immer
wieder durchgeführt werden. Einerseits
braucht es verschiedene Wasserstände
und andererseits muss der Verlauf der
Bachsohle im Pegelprofil zu jedem Zeit-
punkt bekannt sein. Der Pegelschlüssel
besteht nämlich meist aus mehreren
Schlüsselkurven, deren zeitliche Gül-
tigkeit immer wieder überprüft und neu
festgelegt werden muss.
Damit der Messaufwand künftig so
gering wie möglich gehalten werden
kann, wurde für den Teischnitzbach ein
Pegelgerinne gebaut, das eine stabile
Sohllage erwarten lässt und den bishe-
rigen Messaufwand auf ein Minimum
reduziert. Die Modellversuche dienten
auch der Erstellung einer Schlüsselkur-
ve, die auf der Schautafel im Pegelbe-
reich ersichtlich ist.
Bei der Dimensionierung des Pegel-
gerinnes war es vorteilhaft zu wissen,
wie unterschiedlich die Durchfluss-
mengen sein können. Die Spanne reicht
nämlich von weniger als 30 l/sec (Win-
ter) bis mehr als 20.000 l/sec (Sommer).
Damit auch das extreme Niedrig-
wasser (NNQ) messbar ist, muss das
Pegelgerinne in seinem Längsgefälle,
in seiner Sohlrauhigkeit und in seiner
Sohlbreite entsprechend dimensioniert
werden. Weiters darf kein Geschiebe
im Pegelbereich liegen bleiben, weil das
den Wasserstand verändert (der Pegel-
schlüssel stimmt nicht mehr) und es darf
keinesfalls zu einem sogenannten Fließ-
wechsel kommen. Mit diesem Problem
waren wir übrigens beim Vorgängerpe-
gel beschäftigt.
Fließwechsel bedeutet, dass das Was-
ser im Pegelgerinne bei geringer Was-
serführung „strömt“ und ab einer be-
stimmten Durchflussmenge „schießt“.
Für solche wechselnden Fließzustände
gibt es aber keinen Pegelschlüssel.
Es gibt eben viele Ursachen, warum
ein Pegel nicht zufriedenstellend funk-
tionieren kann. Durch diesen Umstand
können Wartung und Betrieb eines Pe-
gels aufwändig werden.
Der Pegel am Teischnitzbach ist übri-
gens auch mit einem Wasserthermogra-
phen ausgestattet und mit einer Fern-
übertragungseinrichtung. Dadurch sind
die Messwerte online unter https://www.
tirol.gv.at/umwelt/wasser/wasserkreis-lauf/hydro-online/ abrufbar.
Messergebnisse
Was wir über den Teischnitzbach
inzwischen erfahren haben:
Sämtliche Angaben stammen von der
Pegelstelle am Ausgang des 13,9 km²
großen Einzugsgebietes in Spöttling.
(1) Aufgrund der Vergletscherung ist
die Wasserführung im Sommer auch
Abbildung 1: Abflussganglinie des Teischnitzbaches im „Jahrhundertsommer 2003“
Pegel Teischnitzbach