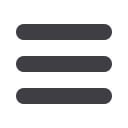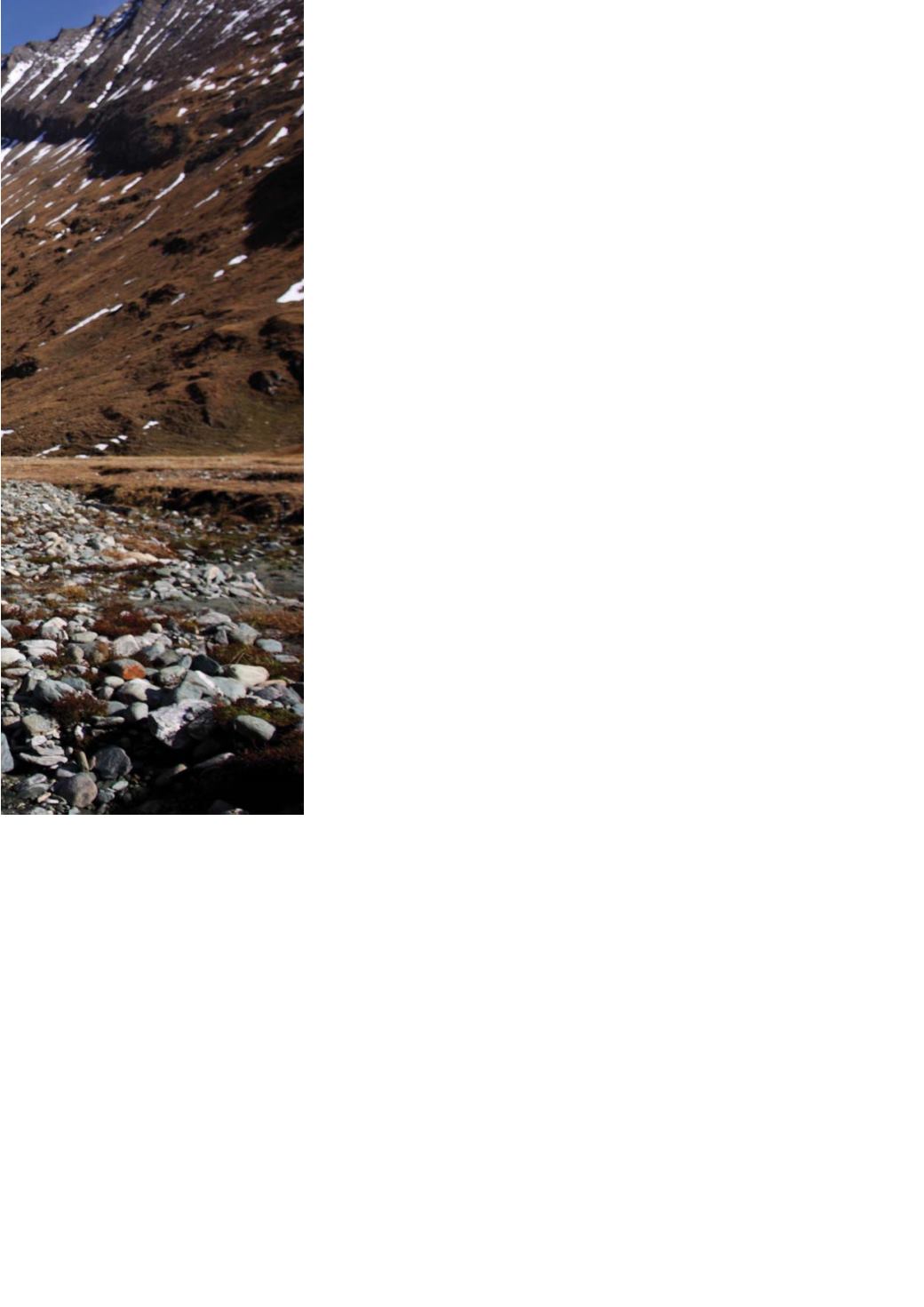
FODN - 60/02/2015
23
UMWELT & NATUR
Hydrographische Kenngrößen
des Teischnitzbaches
Neben den Angaben von Einzugsge-
bietsfläche, Gewässerlänge und Ver-
gletscherung charakterisieren folgende
Merkmale ein Fließgewässer aus hyd-
rographischer Sicht: Pegelstände, Was-
serführung (Hochwasser, Mittelwasser,
Niedrigwasser), Wassertemperatur, Eis-
bildung, Feststoffführung (Schwebstoff
und Geschiebe) und Fließgeschwindig-
keit.
Der Hydrographische Dienst
in Österreich
Die Organisation des Hydrographi-
schen Dienstes in Österreich wurde
1893/94 im damaligen Ministerium des
Inneren bewerkstelligt. Auslöser für
die Einrichtung einer solchen Instituti-
on (Hydrographisches Centralbureau)
waren Hochwasser- und Dürrekatastro-
phen in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Sie führten europaweit zur Gründung
von Hydrographischen Diensten.
Seither gibt es den Hydrographischen
Dienst in Österreich bzw. die hydrogra-
phischen Landesdienste. Die Besorgung
des Dienstes erfolgt in mittelbarer Bun-
desverwaltung (Minister, Landeshaupt-
mann). Die fachliche Koordination ob-
liegt der Abteilung IV/4-Wasserhaushalt
im Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft in Wien. Die Aufgaben
des Hydrographischen Dienstes Tirol
werden vom Sachgebiet Hydrographie
und Hydrologie in der Abteilung Was-
serwirt-schaft beim Amt der Tiroler
Landesregierung wahrgenommen. Der
gesetzliche Auftrag ist im Österreichi-
schen Wasserrechtsgesetz 1959, i.d.g.F.
(davor im Hydrographiegesetz) veran-
kert und in der Wasserkreislaufverord-
nung präzisiert
Pegelmessungen
Die Hydrographie und Hydrologie ist
eine relativ junge Wissenschaft, obwohl
erste Pegelbeobachtungen bereits um
3000 v.Chr. (und davor) als Grundlage
für Wasserbauten im Vorderen Orient,
Mesopotamien, Ägypten, Indien, Alt-
china, Java und in den Inkastaaten Süd-
amerikas durchgeführt wurden.
Mit der Gründung des Hydrographi-
schen Dienstes in Österreich wurden u.a.
auch Pegelmessungen zur staatlichen
Aufgabe erklärt. Schließlich geht es um
die Erhebung des Wasserkreislaufes mit
geeigneten Messeinrichtungen (siehe
Schautafel am Pegel Teischnitzbach).
Wie und wo sonst sollten die oben er-
wähnten charakteristischen Merkmale
eines Gewässers erhoben werden, wenn
nicht am interessierenden Gewässer
selbst.
Der Pegel am Teischnitzbach
Rückblick
. Bevor seitens des Hydrogra-
phischen Dienstes Tirol der Teischnitz-
bach in das hydrographische Interesse
gerückt ist, hat die Elektrizitätswirt-
schaft ein Auge auf dieses Gewässer
geworfen.
Die AEG hat bereits am 1. Oktober
1930 mit ersten Wasserstandsbeobach-
tungen am Teischnitzbach begonnen.
Zu diesem Zweck wurde ein Lattenpe-
gel installiert, der (wahrscheinlich) täg-
lich einmal beobachtet wurde. Ab 1938
wurden diese Lattenpegelbeobachtun-
gen durch die Alpenelektrowerke AG
fortgesetzt.
Nach dem endgültigen Aus für das
Kraftwerksprojekt Kals-Matrei hat
der Hydrographische Dienst Tirol mit
1. Juli 1993 den Pegel in seine Betreu-
ung übernommen (Kaufpreis: ATS
5.000,--). Wie groß der Wartungs-und
Betreuungsaufwand für einen Pegel
an einem Wildbach ist, lässt sich an
der Schautafel „Die Pegelgeschichte“
im Pegelbereich des Teischnitzbaches
nachvollziehen. Nach dem schadenbrin-
genden Hochwasser im Juli 2006 wurde
der alte Pegel geschleift und im Jahre
2010 entsprechend den Ergebnissen der
Modellversuche an der Universität Inns-
bruck, Institut für Infrastruktur, durch
den Forsttechnischen Dienst der Wild-
bach- und Lawinenverbauung, Gebiets-
bauleitung Osttirol, neu errichtet. Der
Wildbach- und Lawinenverbauung ob-
liegt auch die technische Betreuung des
Teischnitzbaches. Der Pegel wurde nach
neuestem Kenntnisstand und unter Ein-
bringung langjähriger Erfahrungswerte
neu gebaut und funktioniert seither völ-
lig problemlos. Der Aufwand hat sich
gelohnt. Der Hydrographische Dienst
hat seitdem 1 Sorgenkind weniger.
Die technische Ausstattung des Pegels
Mit den installierten Messgeräten
sind dem Teischnitzbach einige Ge-
heimnisse zu entlocken, die für die Be-
antwortung verschiedener Fragestellun-
gen von großem Interesse sind.
Der eigentliche Wasserstandspegel
besteht aus einem Lattenpegel, einem
RADAR-Pegel und einer Drucksonde.
Die drei voneinander unabhängig funk-
tionierenden Pegelstandsmesser dienen
der ganzjährigen kontinuierlichen Pe-
gelmessung und Gerätekontrolle.
Mit der Pegelmessung wird aber nur
der Wasserstand erfasst, sonst nichts.
Interessanter als der Wasserstand sind
aber in der Regel die Abflüsse. Nur: Die
direkte Messung von Abflüssen ist (fast)
ein Ding der Unmöglichkeit, jedenfalls
war es so bis zum Neubau der Pegelan-
lage.
Auch die AEG konnte 1930 nur Was-
serstände beobachten. Aber für die Pla-
nung eines Wasserkraftwerkes braucht
es Angaben zum Abflussgeschehen,
und da wird’s aufwändig.