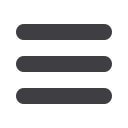
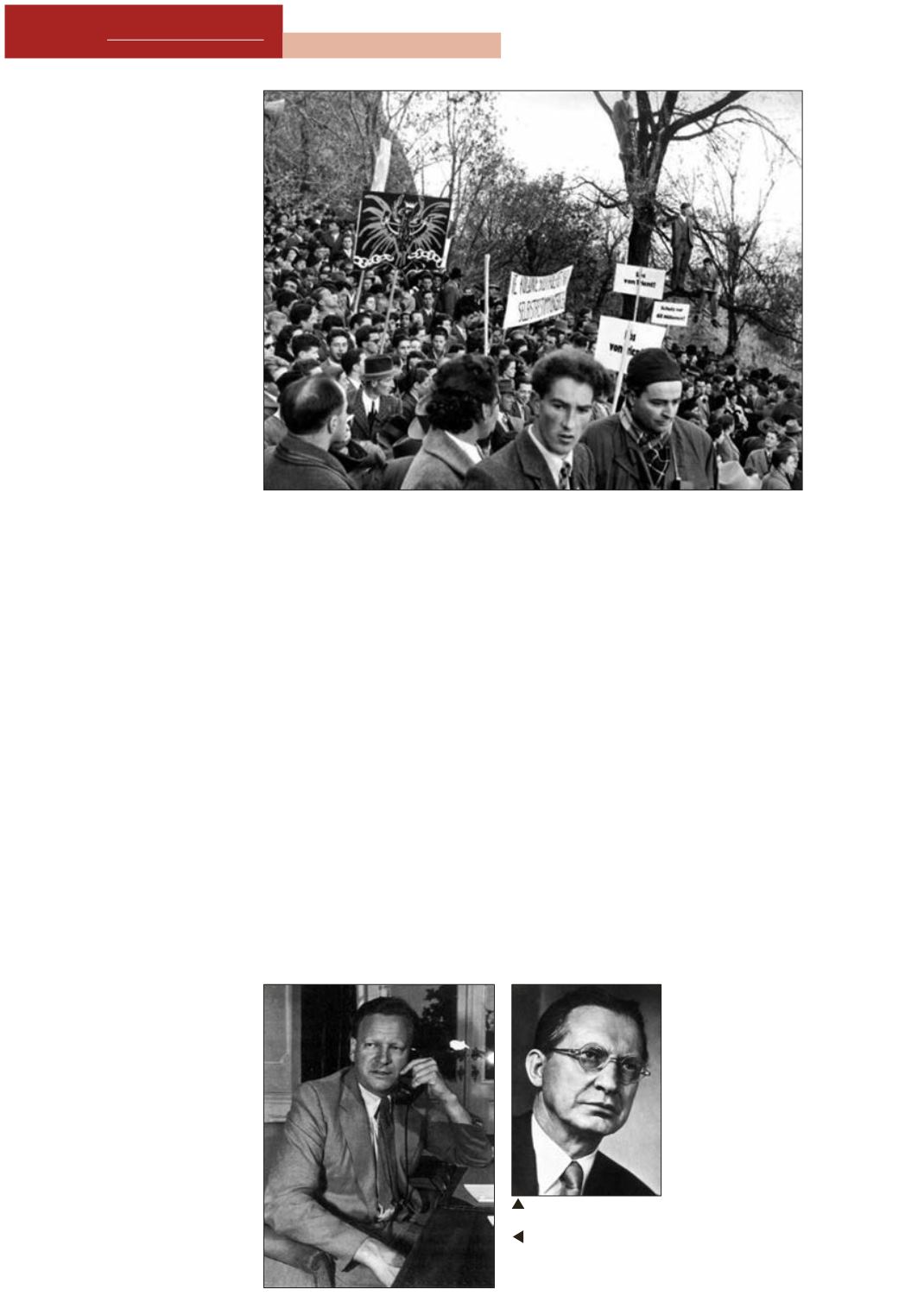
CHRONIK
PUSTERTALER VOLLTREFFER
SEPTEMBER/OKTOBER 2016
20
Donaumonarchie. Renner, der
Staatskanzler von 1918 und
1945, erlebte in Paris 1919 das
Friedensdiktat der Sieger-
mächte. 1946 war er Bundes-
präsident. Hugo Portisch sagte
über Renner in „Österreich II“:
„Stalin war ein Fuchs, aber
Renner war noch der größere
Fuchs.“ Jeden Schachzug des
Degasperi hätte der alte
„Fuchs“ durchschaut. Er kannte
Degasperi noch persönlich vom
Reichsrat in Wien. Den Ver-
such, die eigene Heimat, das
Trentino, scheinbar nebenbei
„mit in die Autonomie zu neh-
men“, hätte Renner richtig ge-
deutet. Das war Politik wie im
alten Reichsrat. Dort versuchten
bis 1914 alle Abgeordneten, für
ihr Volk Sonderrechte heraus-
zuschlagen. Das wiederholte
Degasperi 1946 auf Kosten
Südtirols. Degasperis Spruch, er
habe „das politische Geschäft in
Wien gelernt“, darf man glau-
ben. Für Renner wäre klar ge-
wesen, dass das Trentino De-
gasperis Hauptanliegen war.
Solange die Brennergrenze
blieb, kehrte Degasperi sowieso
als Sieger nach Rom zurück.
Zwangsehe
Für seine Zustimmung zur
Trentino-Autonomie hätte Gru-
ber nach Belieben Sonderrechte
für Südtirol einfordern können.
Das Kleingedruckte interes-
sierte die große italienische Öf-
fentlichkeit nicht die Bohne.
Durch die Unkenntnis der
österreichischen Geschichte
und die Ausschaltung des er-
fahrensten österreichischen Po-
litikers blieb es beim Hände-
druck und der nachfolgenden
Zwangsehe Südtirols mit dem
dominierenden Trentino.
Degasperi formulierte schlau.
Natürlich konnte auch er nicht in
Italien eine Autonomie für eine
italienischsprachige Provinz
durchsetzen. Als Vorwand dien-
ten ihm die – im Originaltext –
„bilingual townships of the
Trento-Province“. Ein altertüm-
liches Wort für Gebiet oder Ge-
meinde, überhaupt nicht näher
bestimmt. Kein anderer italieni-
scher Spitzenpolitiker hätte etwas
von den winzigen deutschen
Dörfern im Trentino gewusst und
sie für die Sonderstellung einer
ganzen Provinz benützt.
Der zynische Umgang der
Trentiner mit der Autonomie
erreichte mehrere Tiefpunkte,
so 1971. Eine Diskussion über
die deutschsprachigen Dörfer
des Trentino würgte Regional-
ratspräsident Luigi Dalvit ab.
Es gäbe keine deutschen Dör-
fer. Dabei stehen sie im ersten
Satz des Pariser Vertrages. Zu-
letzt erwähnte Österreich diese
Dörfer bei der Streitbeilegung
in Sachen Südtirol vor der
UNO im Juni 1992: „Bei die-
sem für die Südtiroler so be-
deutsamen Schritt sind die An-
liegen der deutschsprachigen
Bewohner von Lusern und den
Gemeinden des Fersentals kei-
neswegs in Vergessenheit gera-
ten.“ Schön formuliert, aber in
den letzten 50 Jahren erlebte
ich nur zwei österreichische
Politiker, die sich dafür ein-
setzten, Außenminister Mock
und LH Weingartner.
Das eigentliche Ziel, eine
Südtirol-Autonomie frei von
Trient, erkämpften Bozen und
Wien in den Siebzigerjahren,
fast 30 Jahre nachdem Gruber
der Trento-Autonomie ah-
nungslos und ohne die ge-
ringste Gegenleistung zuge-
stimmt hatte.
Der fast selige
Degasperi
Als Trentiner die Seligspre-
chung Degasperis vorbereiteten,
titelte eine Zeitschrift in Bozen
„Der selige Heuchler“. Ich
machte darüber eine Sendung.
Die beste Antwort gab Landes-
hauptmann Silvius Magnago:
nach 1945 hochverehrte Lan-
desmutter wurde in Österreich
totgeschwiegen, denn sie hatte
Wien nicht um Erlaubnis ge-
fragt, ob sie politisch aktiv sein
dürfe. Sie rief Deutsche ins
Land. Es wanderten auch viele
Tiroler Großfamilien, wie die
Holzmeister, nach Brasilien aus.
Drei Holzmeister wurden Mil-
lionäre, einer mit Kaffee, einer
mit Kühlschränken und der
dritte, Wolfgang, ein Neffe des
berühmten Architekten Cle-
mens, heiratete die Erbtochter
einer Privatbank in Rio. Dieser
Wolfgang war ein charmanter
Netzwerker, so wie sein Onkel,
auf Du mit allen Staatspräsiden-
ten und Ministern. Er erklärte
Außenminister Joao Neves die
Südtirolfrage und sagte vor des-
sen Reise nach Paris: „Schau
mir ja, dass Südtirol zu Öster-
reich kommt“. Neves sicherte
das zu und erwartete den öster-
reichischen Außenminister Karl
Gruber. Der hatte von den Sym-
pathien Brasiliens keine Ah-
nung. Sechs Jahre später luden
die Brasilianer den immer noch
ahnungslosen Gruber nach Rio
ein und drängten ihm ihre Hilfe
förmlich auf. Sie brachten
Staatsvertrag und Besatzung vor
die UN-Vollversammlung und
bescherten Österreich seinen
größten Triumph vor der UNO:
48:0 Stimmen für einen raschen
Abschluss des Staatsvertrages.
Die Siegermacht Brasilien
hatte keine Forderungen an die
Besiegten. Hätte Brasilien eine
Volksabstimmung für Südtirol
gefordert, USA und Sowjets hät-
ten sich dem nur schwer wider-
setzen können. Leider hatte
Degasperi die brasilianische Hal-
tung viel zu früh erfahren und
alles abgeschlossen, bevor es zu
Kontakten mit Österreich kam.
Außerdem glaubten die Sieger-
mächte, der Autonomievertrag
hätte den Südtirol-Konflikt zur
Zufriedenheit aller gelöst.
Das Versagen
Weltpolitische Zusammen-
hänge kannte Gruber nicht.
Bundespräsident Karl Renner
bot an, den politischen Anfänger
zu beraten, doch der „schwarze“
Gruber fühlte sich dem „roten“
Renner überlegen und war bera-
tungsresistent. Gruber galt 1945
als Widerstandskämpfer. Der
rote Renner hatte 1938, so wie
der schwarze Kardinal Innitzer,
für Hitler gestimmt. So betrach-
tet war Gruber der Held, und
Renner die Niete.
Als Renner Reichsratsabge-
ordneter wurde, war Gruber
noch nicht auf der Welt. Als
Gruber in die Volksschule kam,
erschien Renners großes Werk
über die Zukunft der Völker der
Zweite
Groß-
kundge-
bung
„Los
von
Trient“
auf
Burg
Sig-
munds-
kron.
Fotos:
Verlag
Edition
Tirol
Alcide Degasperi.
Karl Gruber.









