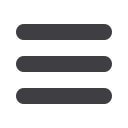
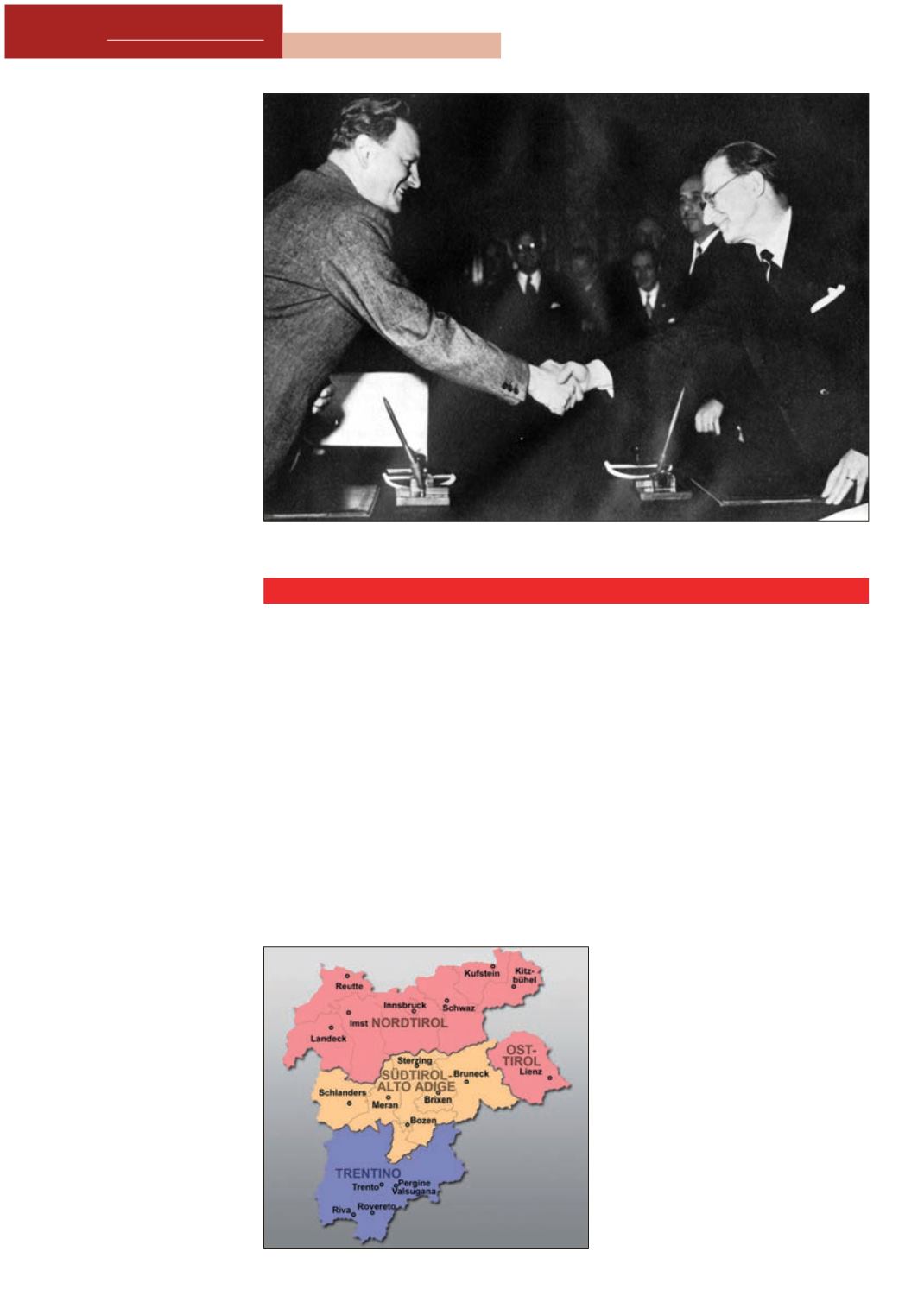
CHRONIK
PUSTERTALER VOLLTREFFER
SEPTEMBER/OKTOBER 2016
18
Das Gruber-Degasperi-
Abkommen nach dem
Zweiten Weltkrieg
sollte den Südtirolern in
Italien weitgehende
Selbstbestimmung er-
möglichen. Nicht in den
Geschichtsbüchern
steht, dass der öster-
reichische Außenminis-
ter mit dem Einbezie-
hen des Trentino über-
rumpelt wurde. Und
auch das Hilfsangebot
Brasiliens wusste
man offenbar nicht zu
nutzen.
Die österreichische Forde-
rung nach einer Volksabstim-
mung für Südtirol lehnten die
Siegermächte im Mai 1946 ab.
Ihr einziges Zugeständnis waren
direkte Verhandlungen zwischen
Österreich und Italien über
einen Vertrag zum Schutz der
deutschen Südtiroler. Die Groß-
mächte zwangen Italien dazu;
denn liebend gern hätte Italien
Südtirol als innere Angelegen-
heit behandelt. Nach der Unter-
zeichnung des nun international
abgesicherten Schutzvertrages
wurde Außenminister Karl Gru-
ber in Innsbruck mit der Ohr-
feige eines Kriegsinvaliden
empfangen. Erregt hat die Ohr-
feige, weil sie Ausdruck der
Stimmung war: Hier ist etwas
schiefgelaufen für Österreich.
Das erstaunt, denn die erschre-
ckenden Auswirkungen des Ver-
trages erkannte man erst mit In-
krafttreten der Autonomie 1948
und die Fehler der österrei-
chischen Seite sind teilweise bis
heute nicht geklärt.
Brisanter erster Satz
Den Pariser Vertrag, über den
seit 70 Jahren diskutiert wird,
liest man in zwei Minuten.
Kein kompliziertes Regelwerk
für Juristen, sondern scheinbar
nur Selbstverständliches wie
Gleichberechtigung, das Recht
auf den Gebrauch der deut-
schen Sprache oder eine
schwammig formulierte Rück-
kehr jener Südtiroler, die durch
das Hitler-Mussolini-Abkom-
men von 1939 das Land verlas-
sen hatten. Doch im ersten Satz
stehen zwei Wörter, die kein
italienischer Außenminister
außer Degasperi eingefügt
hätte. Sie sollten Sprengkraft
erhalten, schlussendlich auch
im wörtlichen Sinn: „Trento-
Province“. Was hat im Vertrag
„zum Schutze der volklichen
Eigenart … der deutschen
Volksgruppe“ Trento verloren?
Der große Tiroler Irrtum
In der Schule habe ich ge-
lernt: In Paris verhandelten ein
ehrlicher, aber unerfahrener
Österreicher und ein raffinierter
alter Italiener. Das ist falsch.
Über Südtirol verhandelten
zwei Tiroler, ein Nordtiroler
und ein Welschtiroler. Patrio-
tisch waren beide. Erst durch
mein letztes Interview mit
Friedl Volgger weiß ich etwas
Unglaubliches: Italiens Minis-
terpräsident und Außenminister
Alcide Degasperi sprach besser
Deutsch als Italienisch. „Eco
L‘Austriaco!“, Hört, der Öster-
reicher, höhnten die Kommu-
nisten, wenn er im Parlament
ein fehlerhaftes Italienisch
sprach.
Ich kenne niemanden, der
Degasperi besser charakteri-
sierte als sein Erzfeind Benito
Mussolini. Als Chefredakteure
der sozialistischen und der
konservativen Zeitung in Trient
diskutierten beide am 7. März
1909 in Meran. Mussolini, der
damals übrigens leidlich
Deutsch lernte, schrieb über
Degasperi, er denke nicht und
er spreche nicht wie ein Italie-
ner, sondern „wie ein Tiroler
Gefreiter oder Portier“. Jeden
Satz beginne er „in bezug auf“.
1914 wurde Mussolini ein
Hauptagitator für den Krieg
gegen Österreich. 1914 erschien
Degasperi mit weiteren Trenti-
ner Abgeordneten bei Kaiser
Franz Joseph. Alle traten für ein
österreichisches Trient ein. Der
Kaiser war bereit, für die Neu-
tralität Italiens das Trentino zu
opfern, nicht aber Triest, seinen
einzigen Handelshafen. Nach
der Aussprache schrieb Fried-
rich Funder, Chefredakteur der
Reichspost: Gute Patrioten
haben uns heute verlassen.
Degasperi, der enttäuschte
Österreicher, blieb bis 1918
Reichsratsabgeordneter
in
Wien. Ab 1918 wollte er eine
Autonomie für seine Heimat
Nicht nur
Südtirol
wurde in
das Auto-
nomie-
paket
aufge-
nommen,
sondern
über-
raschen-
derweise
auch
Trient.
Fotos:
Verlag
Edition
Tirol
Vom Vertragsabschluss gibt es keine Bilder. Die Aufnahme zeigt Gruber (l.) fünfeinhalb Jahre spä-
ter in Rom anlässlich der Unterzeichnung des italienisch-österreichischen Kulturabkommens.
5. September 2016 – 70 Jahre Gruber-Degasperi-Abkommen über Südtirol:
Ein kleiner Vertrag mit









