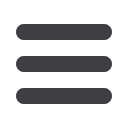
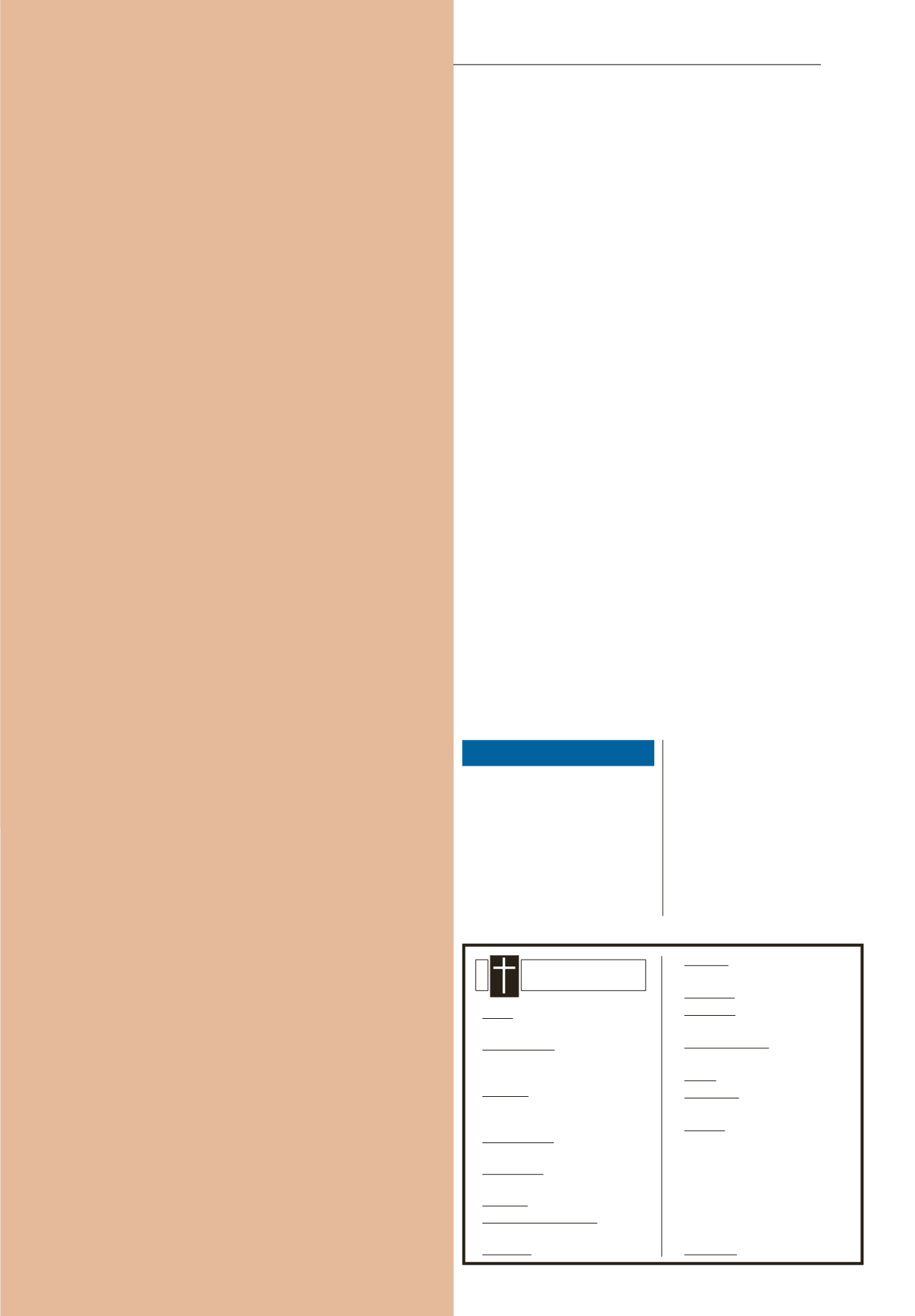
23
OBERKÄRNTNER
VOLLTREFFER
Zeilen der Erinnerung
an Hans Oberluggauer
In einem neuen Buch wird
auch an den verunglückten Le
sachtaler Hans Oberluggauer ge
dacht. Andreas Gnesda ist Grün
der der Beratungsgruppe „team
gnesda“ in Wien, die seit über
dreißig Jahren Organisationen
bei der Entwicklung neuer Ar
beitswelten begleitet. Er ist auch
Präsident des Österreichischen
Gewerbevereins. In seinem neu
en Buch mit dem Titel „Next
World of Working“ (Molden
Verlag, 2016) folgt er seinem
selbst entwickelten Modell und
seinem Credo, wonach Erfolg
mehr ist als eine positive Bilanz
und fette Gewinne. Es geht um
nachhaltiges Management, er
folgreiche Organisation, gute
Arbeitsumgebung und um noch
viel mehr, heißt es doch im Un
tertitel des Buches „Zu den Gip
feln eines sinnerfüllten Lebens“.
Anhand der Metapher einer Ski
tour gibt Andreas Gnesda Ein
blicke in seine Biografie und
gibt den Lesern Denk und Re
flexionsanstöße zur persönlichen
Entwicklung und zu mehr
Selbstbestimmtheit. In zwölf
Etappen führt der Autor zu
einem sinnerfüllteren Leben,
ausgehend vom Kennen seiner
eigenen Bedürfnisse. Das Buch
enthält auch Zeilen der Erinne
rung an seinen Lesachtaler
Freund und Bergführer Hans
Oberluggauer (19742015) so
wie auch ein Foto. Den sehr er
fahrenen Tourguide hatte er im
Kaukasus beim Heliskiing ken
nengelernt, sie wurden Freunde.
Sie machten mehrere Berg
touren, u. a. auf den Großvene
diger, Großglockner und in der
Schweiz. Er schildert die gute
Vorbereitung für sich und für
seine Gäste, die für Hans ein
Muss war. Hans war für ihn ein
großartiger Bergführer und wert
voller Freund, schreibt Gnesda,
dankbar für die Bereicherungen,
die er durch ihn erfahren konnte.
Der Landwirt und staatlich
geprüfter Berg und Skiführer
Hans
Oberluggauer
aus
Tscheltsch bei Liesing war am
21. Juni 2015 im Alter von 41
Jahren in Ausübung seines Be
rufes im Glocknergebiet tödlich
verunglückt.
Karl Brunner
Todesfälle
Berg: Aloisia Mandler
(90)
Paul Machne
(74)
Dellach/Gail:
Sidonie Wassermann
(90)
Werner Mörtl
(65)
Gmünd:
Gerlinde Kohlweiss
(67)
Anna Pichler
(91)
Heiligenblut:
Christian Pichler
(82)
Hermagor:
Ing. Gottfried Wettl
(69)
Irschen: Johann Oberlojer
(85)
Kötschach-Mauthen:
Marianne Kubin
(94)
Lendorf: Maria Preimeß
(94)
Liesing:
Hannelore Unterluggauer
(55)
Mallnitz: Alois Stranig
(70)
Millstatt:
Annelies Schmölzer
(76)
Oberdrauburg:
Barbara Wies ecker
(100)
Penk: Josefa Gasser
(88)
Rennweg:
Katharina Rauter
(85)
Spittal: Ines Schanner
(83)
Pauline Kalt
(77)
Wilhelmine Steiner
(103)
Marianne Pontasch
(96)
Albert Waltl
(83)
Rosemarie Fink
(77)
Emil Waltl
(86)
Maria Kogler
(99)
Steinfeld: Alfred Lassnig
(89)
Kurzmeldung
Gottesdienst für
Liebende
Die Pfarre Spittal lädt am Sams-
tag, 11. Feber, um 19 Uhr zu
einem Gottesdienst für Liebende
mit Familienseelsorger Michael
Kopp und Dechant Ernst Wind-
bichler in die Stadtpfarrkirche.
Ehepaare (kirchlich getraut oder
standesamtlich verbunden), Ver-
liebte und Verlobte, Einzelper-
sonen, die von ihrem geliebten
Partner örtlich oder durch den
Tod getrennt sind, sowie diejeni-
gen, die noch auf der Suche nach
einem Partner sind, sind herzlich
willkommen. Musikalische Ge-
staltung: Ernst Jeschke.
um Mitglieder und setzen sich
damit der obrigkeitlichen Verfol
gung aus. Denn das Täufertum
war auch im protestantischen Sie
benbürgen streng verboten. 1767
flohen die Hutterer über die Süd
karpaten in die Walachei und ge
rieten dort in den russischosma
nischen Krieg. Damals besteht
die Gruppe aus 51 Kärntnern und
nur noch 16 Althutterern. Die
russische Zarin Katharina II. er
laubt die Ansiedlung der tüch
tigen Glaubensflüchtlinge im da
maligen Südrussland (heute Ost
ukraine). Als Russland 1871 die
allgemeine Wehrpflicht einführt,
begeben sich hutterische Send
boten auf die Suche nach Land in
Amerika. 1874 bis 1877 emi
grieren alle der damals 1.265
Hutterer in die Neue Welt. 1917
treten die USA in den Ersten
Weltkrieg ein, und viele Hutterer
kommen als Kriegsdienstverwei
gerer nach Alcatraz. Zwei hutte
rische Brüder sterben nach Miss
handlungen im Gefängnis. Des
halb wandern die Hutterer nach
Kanada aus. Später legen die
Hutterer ihre neuen Höfe auch
wieder in den USA an.
Landler
Hier seien auch die „Landler“
in Siebenbürgen (Rumänien) nä
her beleuchtet. 4.000 Personen
wurden wegen ihres protestan
tischen Glaubens im 18. Jht. un
ter Kaiser Karl VI. und Maria
Theresia nach Siebenbürgen (da
mals Kronland der Monarchie)
deportiert. Viele starben. Nur
etwa 850 konnten in den Dör
fern Neppendorf, Großau und
Großpold nahe Hermannstadt/
Sibiu bleibend angesiedelt wer
den und lebten dort in enger
Nachbarschaft mit den ebenfalls
lutherischen Siebenbürger Sach
sen. Die Landler stammten aus
der Obersteiermark und Kärnten
und vor allem aus dem ober
österreichischen Salzkammergut
und dem Hausruckviertel, dem
sogenannten „Landl“ (nach dem
die Transmigranten insgesamt
als „Landler“ benannt wurden).
Die Großpolder Landler stamm
ten aus Oberösterreich und
Oberkärnten, was sich sprach
lich durch das starke südbai
rische Element in der Großpol
der Landlermundart auswirkte.
Auch die Landler sind tief gläu
bige evangelische Christen.
Nach der Wende 1989/90 sind
viele Deutschsprachige Rumäni
ens nach Deutschland, etliche
aber auch nach Oberösterreich
ausgewandert.
Kärntner Merkmale
Ein Experte, der sich mit Spra
che und Kultur der deutschspra
chigen Gruppen in Rumänien, der
Ukraine sowie in Nordund Süd
amerika intensiv auseinanderge
setzt hat, ist der aus dem Gailtal
stammende Sprach und Kultur
forscher Professor Wilfried Scha
bus. Zuletzt hat er ein großes
Werk über „Pozuzo. Auswanderer
aus Tirol und Deutschland am
Rande Amazoniens in Peru“ ver
öffentlicht. Besonderes Augen
merk richtet Schabus auch auf die
historischen Hintergründe, die
Menschen einst zum Verlassen
der Heimat veranlasst und somit
zur Entstehung von „Sprach
inseln“ geführt haben, seien es
wirtschaftliche Not oder brutale
konfessionspolitische Verfolgung.
Wie Schabus feststellt, sind nicht
alle nach Siebenbürgen ver
schleppten Kärntner, wie von
Maria Theresia beabsichtigt, zu
protestantischen „Landlern“ ge
worden, vielmehr haben sich etli
che in Siebenbürgen den täufe
rischen Hutterern angeschlossen.
Wäre dies nicht der Fall gewesen,
meint Schabus, würde es die heu
tige „Hutterian Brethren Church“,
die „Kirche der Hutterischen Brü
der“, nicht geben, denn die nach
1620 in die Slowakei geflohenen
Hutterer, die sogenannten „Haba
ner“, mussten ihr Täufertum bald
aufgegeben. Auch der Alltagsdia
lekt der Hutterer zeigt bis heute
unverkennbare Kärntner Merk
male auf.
Sowohl über Sprache und Kul
tur der Landler als auch über die
Hutterer hat Schabus publiziert,
bei den Hutterern in Kanada
konnte er drei Monate als Feld
forscher verbringen. Mehr als die
Hälfte der heute etwa 46.000
Hutterer tragen die Familienna
men Kleinsasser, Hofer, Wurtz,
Glanzer und Waldner. Diese Na
men stammen aus der Gegend
von Spittal und bezeugen somit
wie auch ihre Mundart die enge
historische Verbundenheit der
Hutterer mit Oberkärnten. 1996
hat Schabus ein Buch über „Die
Landler. Sprach und Kulturkon
takt in einer altösterreichischen
Enklave in Siebenbürgen (Rumä
nien)“ herausgebracht, 2002 war
er als Autor und Mitherausgeber
an dem zweibändigen Standard
werk „Die siebenbürgischen
Landler“ (Böhlau) beteiligt. 2011
erschien von ihm in der Carinthia
I der illustrierte Beitrag „Die täu
ferischen Hutterer und ihre
Kärntner Sprachgeschichte“.
Karl Brunner









