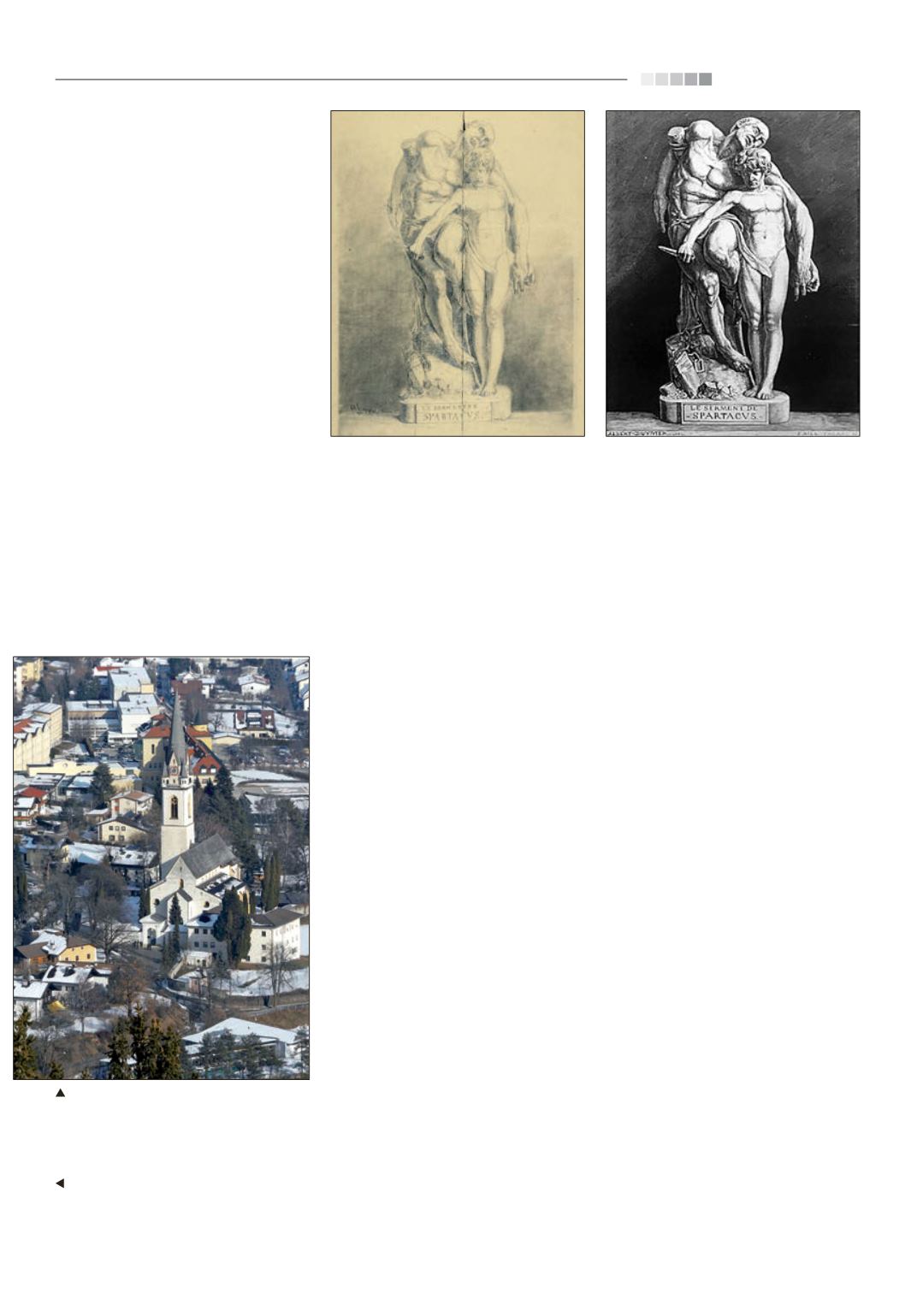
OSTTIROLER
NUMMER 1/2018
3
HEIMATBLÄTTER
rer“. Es verwundert nicht, dass er in kind-
lichem Alter auch den Eindruck, den das
Heilige Grab auf ihn machte, für ein Stück
Wirklichkeit nahm und sich weniger für
die Illusion als für deren Konstruktion in-
teressierte.
Eine aus der Mitte nach rechts gerückte
senkrechte Linie durchmisst die gesamte
Höhe des Blattes und stellt als Achse der
bilateral-symmetrischen Architektur deren
linke Hälfte ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Außer ein Lineal und einen Zir-
kel, dessen Einstich im oberen Abschnitt
der Mittellinie gut erkennbar ist, und der in
gestuften Radien das Profil des Bogens
umreißt, hat Egger keine Hilfsmittel ver-
wendet. Er verlässt sich ganz auf sein
Auge, seine Intuition und einen sehr harten
Bleistift, der keine Fehler verzeiht. Durch
Variationen der Strichstärke, durch schraf-
fierte Schattierungen und die verblassende
Andeutung der hinteren Raumschicht
gelingen ihm auch feinsinnige malerische
Effekte, die stellenweise jedoch auch den
naiven Zugang zum Motiv verraten: Die
Schlagschatten, welche die vorspringen-
den Architekturteile der mittleren Raum-
schicht auf den Boden werfen, lassen diese
an den einzigen Stellen, an denen ihr fla-
cher, kulissenhafter Charakter abzulesen
wäre, wieder als körperhafte Gebilde er-
scheinen.
Anton Zoller wusste genau, warum er
seinem Betrachter den Blick auf den Büh-
nenboden versagte, der in der Zeichnung
weit über das von der Perspektive des Vor-
Albin Egger, St. Andrä mit Umgebung,
vom Schlossberg aus gesehen, Bleistift auf
Papier, 298 x 204 mm, 1881 (Ausschnitt).
(Orig. Museum Schloss Bruck)
Foto: Alois Baptist
Die Pfarrkirche St. Andrä mit Umge-
bung, vom Schlossberg aus fotografiert;
Aufnahme vom 9. Feber 2018.
Foto: Rudolf Ingruber
Albin Egger, Spartakus, Bleistift auf Pa-
pier, 472 x 312 mm, 1881 (Ausschnitt).
(Orig. Museum Schloss Bruck)
Foto: Alois Baptist
Albert Duvivier/Emile Thomas, Stich nach
der Originalplastik „Le Serment de Spar-
tacus“ von Louis-Ernest Barrias.
bilds geforderte Niveau ansteigt. Aller-
dings kann sich Egger auch für keinen fes-
ten Standpunkt entscheiden. Die in die
Tiefe fluchtenden Kanten der vorderen
Säulensockel fallen steil ab, fluchten in
einen Punkt weit unter dem natürlichen
Betrachterniveau und geraten postwen-
dend in einen zeichnerisch nicht mehr zu
lösenden Konflikt mit der obersten Tritt-
stufe des Stiegenaufgangs. Dort, wo sich
der Zeichner aber sicher war, hat er den
Strich zum Schluss bekräftigt und ver-
stärkt.
„Landschaft mit einer Klosteranlage“
– Bereich von St. Andrä
In der Bleistiftskizze auf der Rückseite
des Blattes geht die blasse Zeichnung zum
großen Teil im Eigenrauschen des Papiers
auf. Wilfried Kirschl bezeichnet sie als
„Landschaft mit einer Klosteranlage“
9
, ein
Titel, den Gert Ammann übernimmt.
10
Da
Kirschls Liste die Vorderseite unter den
„Studien nach Gipsmodellen und Vorla-
gen“ rubriziert, wurde die Möglichkeit
einer nach der Natur verfassten Zeichnung
wahrscheinlich nie erwogen. Man hätte
sonst erkennen müssen, dass die beiden
Klöster seiner Heimatstadt, über deren
Grenzen der Aktionsradius des Dreizehn-
jährigen wohl kaum hinausgereicht hat,
keine Übereinstimmungen mit dem fest-
gehaltenen Motiv aufweisen, und stattdes-
sen nach einem Turm Ausschau gehalten,
der das Ortsbild heute ähnlich prägt wie
der in Eggers Zeichnung.
Es ist der Turm von St. Andrä, freilich
noch nicht in seiner gegenwärtigen Gestalt
und Höhe, die ihm erst die neugotisch in-
spirierte Renovierung 1909 verlieh. Der
von Egger porträtierte Turm, mit abge-
trepptem Glockengeschoss, rundbogigem
Schallfenster und stumpfem Pyramiden-
helm, wurde nach 1737 errichtet
11
, doch
lassen sich von diesem Konstruktions-
punkt aus, den auch etliche historische
Aufnahmen dokumentieren, die restlichen
Gebäude problemlos zuordnen: das Hoch-
schiff und das niedrigere Seitenschiff mit
dem markanten Strebepfeiler in der Süd-
westecke der Basilika, die dort jedoch vom
dreigeschossigen Pfarrwidum z. T. ver-
deckt ist; die Westfassade mit dem Portal-
vorbau und schließlich noch der Westteil
der Umfassungsmauer des Kirchhofs mit
seinem 1831 errichteten Eingangstor.
Links vorne ist das ehemalige Mesnerhaus
(heute Kirchenwirt) zu sehen, bei dem der
Zauchenbach vorbeiströmt, bevor er in die
von der Zeichnung nicht erfasste Isel mün-
det. Schließlich ist auch noch vom Baum-
bestand zu abstrahieren, der sich in 140
Jahren naturgemäß verändert hat, was der
topografischen Genauigkeit aber keinen
Abbruch tut.
Dass der zarte Bleistiftstrich darüber
hinaus noch manches offen lässt, ist der
beträchtlichen Distanz geschuldet, aus
welcher das Ensemble aufgenommen
wurde. Egger kann seinen Aussichtspunkt
im Grunde nur am Schlossberg unter der
Venedigerwarte eingenommen haben, das
ihm nicht nur die von oben gesehenen Ge-
bäude vollständig in den Blick zu nehmen,
sondern auch die große Lücke, die das
Iseltal zwischen ihm und dem Motiv auf-
tat, einigermaßen zu schließen erlaubte.
Der Bildaufbau erinnert insgesamt an
Franz Stembergers im Vordergrund stets
durch Staffagefiguren belebte Ansichten
von Lienz
12
, doch ist der Jäger, den Egger
einen steilen Hang hinabschickt, mehr als
bloße Konvention, befand sein Standort
sich doch inmitten eines Jagdgebiets.
Der Schwur des Spartacus
Das Bild zeigt den muskulösen, doch
scheinbar leblosen, nur mit einem Len-
dentuch bedeckten Körper eines älteren
Mannes, der von einem abgesägten Ast
unter der rechten und von einem nackten,
eng an ihn geschmiegten Jüngling unter
der linken Schulter am völligen Zusam-
mensacken gehindert wird. Sein linkes
Bein ist angezogen, während das schräg
fallende rechte durch den Fuß an einen
Baumstumpf genagelt ist. Zwei in die Erde
gerammte Pflöcke und die Glieder einer








