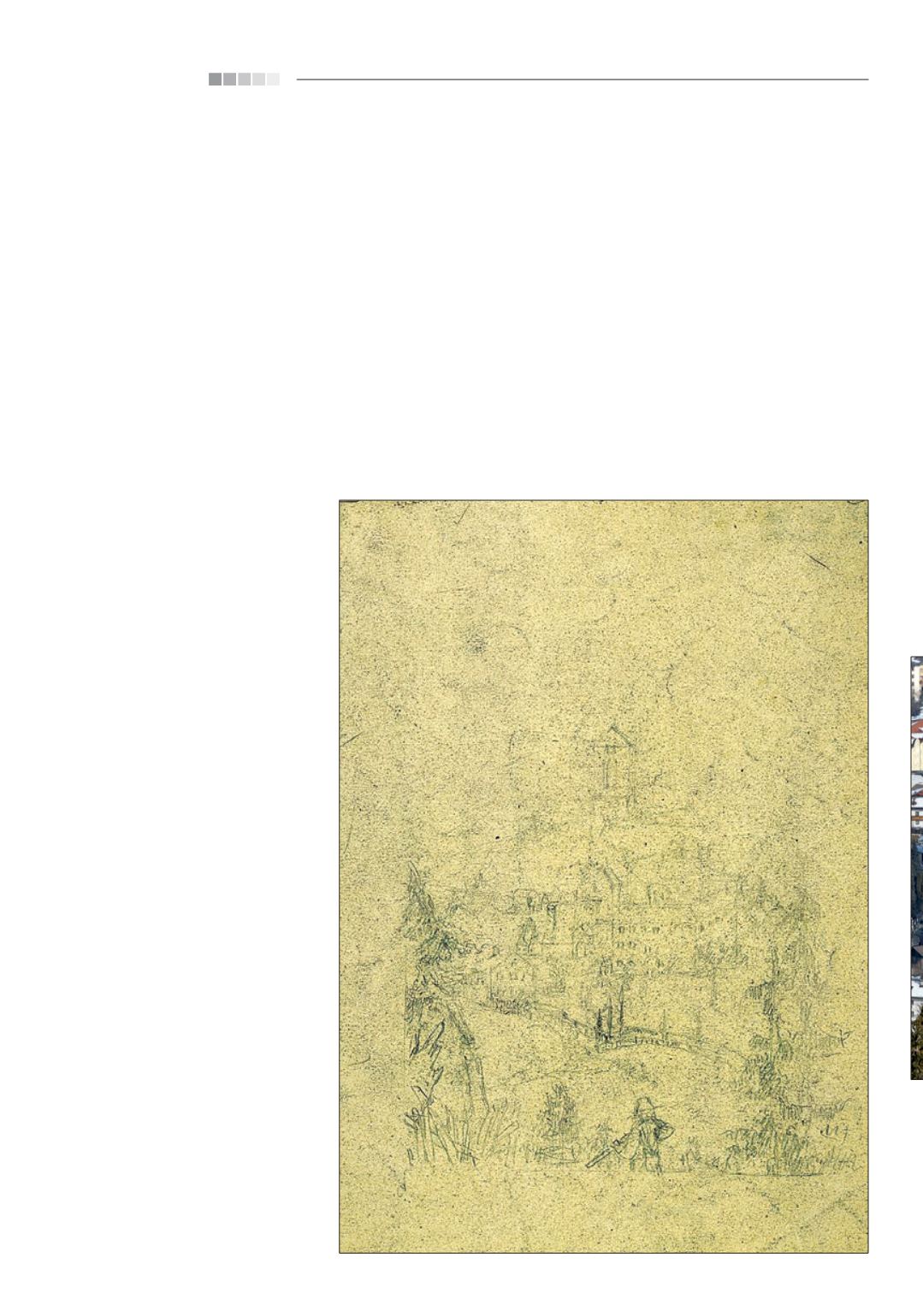
OSTTIROLER
NUMMER 1/2018
2
HEIMATBLÄTTER
Die Frage, ob in diesen von der For-
schung kaum beachteten Zeugnissen schon
der Künstler durchscheint, ist aus knapp
140-jähriger Distanz ganz ohne Pathos nur
mit „nein“ beantwortbar. Eggers Werk
scheint heute auf- und abgearbeitet, von
den späten Gemälden bis zur Studienzeit
rekonstruiert, in Phasen untergliedert und
in die großen kunsthistorischen Zusam-
menhänge eingepflegt. Je ausführlicher die
Rezeptionsgeschichte, die der Künstler
heute nur noch mittelbar beeinflusst, zu
Lebzeiten aber immer wieder aktiv auch
zu steuern suchte, desto klarer wird das
Bild, das aber für die bildnerischen Geh-
versuche bisher noch keinen rechten Platz
gefunden hat.
Hier tritt ein Knabe aus der Welt, die ihn
umgibt, heraus und stellt sie vor sich hin,
um sie mit einem Instrumentarium zu tran-
skribieren, das er sich Schritt für Schritt
zurechtlegen und anverwandeln muss. Wie
aber ist die Welt des jungen Albin Egger
aus Lienz, der sich einst den Namen seiner
Heimatstadt stolz an den seinen heften
wird, beschaffen?
„In meinem sechsten
Jahr verkehrte ich mit Vorliebe auf dem
Dachboden. Ein alter Koffer mit Zeit-
schriften, Büchern, Kupferstichen und dem
Vergolderwerkzeug und Zeichnungen mei-
nes Vaters, eine alte Hausapotheke, ein
Malkasten, sowie in einer Ecke des Daches
verstaubte, aufgerollte Leinwanden (Hei-
ligenbilder) waren dann die Ausbeute.“
2
Der Vater steht als Kirchenmaler in einer
Tradition, die auch in Lienz schon ihre
Götterdämmerung erlebt. Das Gewerbe
eines Fotografen aber trifft den Nerv der
Zeit, hat Zukunft und ist neu, obwohl man
Mitte der 1860er-Jahre, als Georg Egger
das erste Fotoatelier in Lienz eröffnet,
nicht mehr bei null anfangen muss. Das
1835 von Louis Daguerre erfundene Ver-
fahren hatte sich in atemberaubendem
Tempo zum bevorzugten Bildmedium des
Bürgertums entwickelt, dessen Wunsch
nach Repräsentation und Information es
kongenial bediente und dazu noch in der
Lage war, in immer schneller sich verän-
dernden Verhältnissen den Augenblick zu
bannen.
3
Georg Eggers Wunsch, sein Sohn
werde den Betrieb einst übernehmen, ist
daher verständlich, zumal dieser in Lienz
bis 1896 konkurrenzlos blieb.
4
Die Welt des Vaters wird dem jungen
Albin aber bald zu eng, der auf seinen Er-
kundungen der näheren Umgebung das
Angebot des Dachbodens durch jenes der
Natur erweitert. Daher ist es sinnvoll, an
den Beginn eine Zeichnung zu stellen, die
auf merkwürdige Weise Kunst und Wirk-
lichkeit verbindet.
„Barockes Kircheninterieur“ –
Heiliges Grab
Wilfried Kirschl führt die Zeichnung als
„Barockes Kircheninterieur“
5
auf, Lois
Ebner aber hat das Motiv 2001 quasi in
letzter Sekunde vor der Drucklegung des
Bestandskataloges der Egger-Lienz-
Sammlung auf Schloss Bruck als Anton
Zollers „Heiliges Grab“ identifiziert.
6
Der
gelernte Theatermaler aus Telfs schuf es
1752 für die Lienzer Stadtpfarrkirche St.
Andrä, wo es, mit einigen Unterbrechun-
gen, bis zum heutigen Tag alljährlich wäh-
rend der Karwoche im linken Seitenschiff
aufgebaut wird. Bis an den Scheitel des
Gewölbes ragende, über zwei Joche ge-
staffelte Kulissen stellen den Blick durch
einen mächtigen, von Doppelsäulen getra-
genen Bogen auf einen barocken Palasthof
mit halbrundem Schlussprospekt vor.
Stirnseitig führen fingierte Treppen, die
das Grab Christi flankieren, zur Bühne, auf
der zwischen Gründonnerstag und Oster-
montag Leiden, Tod und Auferstehung des
Herrn in mehreren Akten und mit teils
hohemAufwand an gemalten Bretterfigu-
ren in Szene gesetzt werden.
7
Alles ist auf Augentrug abgestellt: Die
Lichtregie, die maßstäbliche Relation der
Akteure und die perspektivische Konstruk-
tion der Kulissen, die mit einem bestimm-
ten, nicht beliebig austauschbaren Betrach-
terstandpunkt kalkuliert. Er befindet sich in
einiger Entfernung zu dem Prospekt, des-
sen am Gebälk und an den Kassetten der
Bogenlaibung ausgewiesene Fluchtlinien in
der Mitte der vorderen Kante des Bühnen-
bodens gebündelt sind. Die Augenhöhe
liegt etwas unter dem durchschnittlichen
Körpermaß heutiger Zuschauer, ist aber
leicht zu eruieren: Wenn der Bühnenboden
verschwindet und das über dem rechten
Säulenpaar scheinbar in den Kirchenraum
fortgesetzte Gebälk mit jenem der realen
gotischen Architektur zu einer geraden
Linie sich verbindet, hat man den Standort
eingenommen, an dem Zollers Raumillu-
sion ihre größte Wirkung entfaltet. Sie
toleriert zwar noch einiges an Bewegung,
das Kunstwerk aber als Potemkin‘sches
Dorf zu entlarven, lag ganz gewiss nicht im
Sinne seines Erfinders.
Egger war das Spektakel sicher schon
von Kindheit an vertraut, wie die Pfarr-
kirche St. Andrä überhaupt eine starke An-
ziehungskraft auf ihn ausgeübt hat. So
stand der gotische Kruzifixus am rechten
Seitenaltar gleich mehrmals für spätere
Kompositionen Modell: Ende der 1880er-
Jahre für ein erst vor knapp zwei Jahr-
zehnten wiederentdecktes Kreuzigungs-
triptychon
8
, 1897/1901 und 1901/1902 für
„Das Kreuz“ und 1904 für „Die Wallfah-








